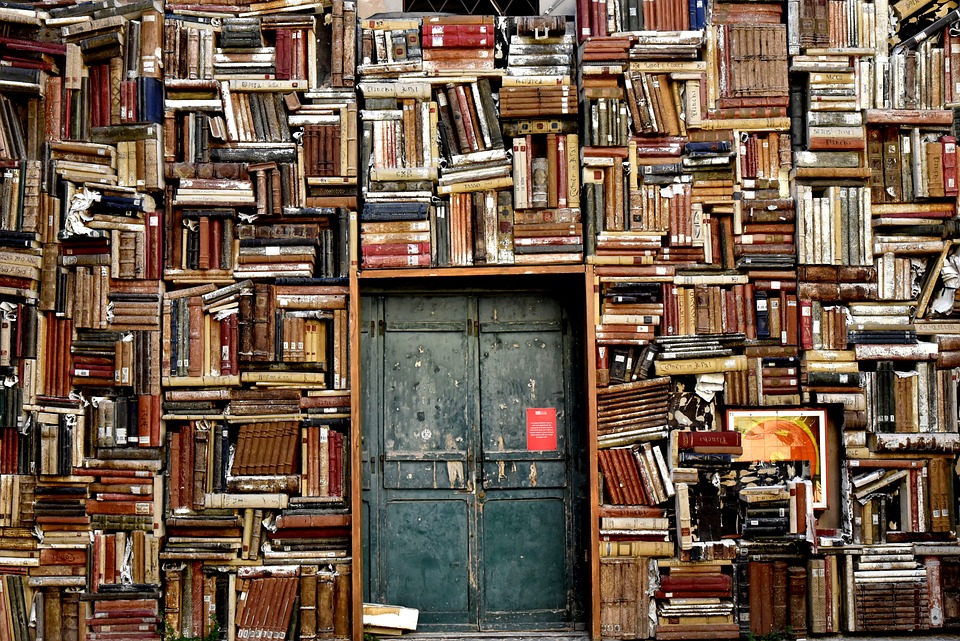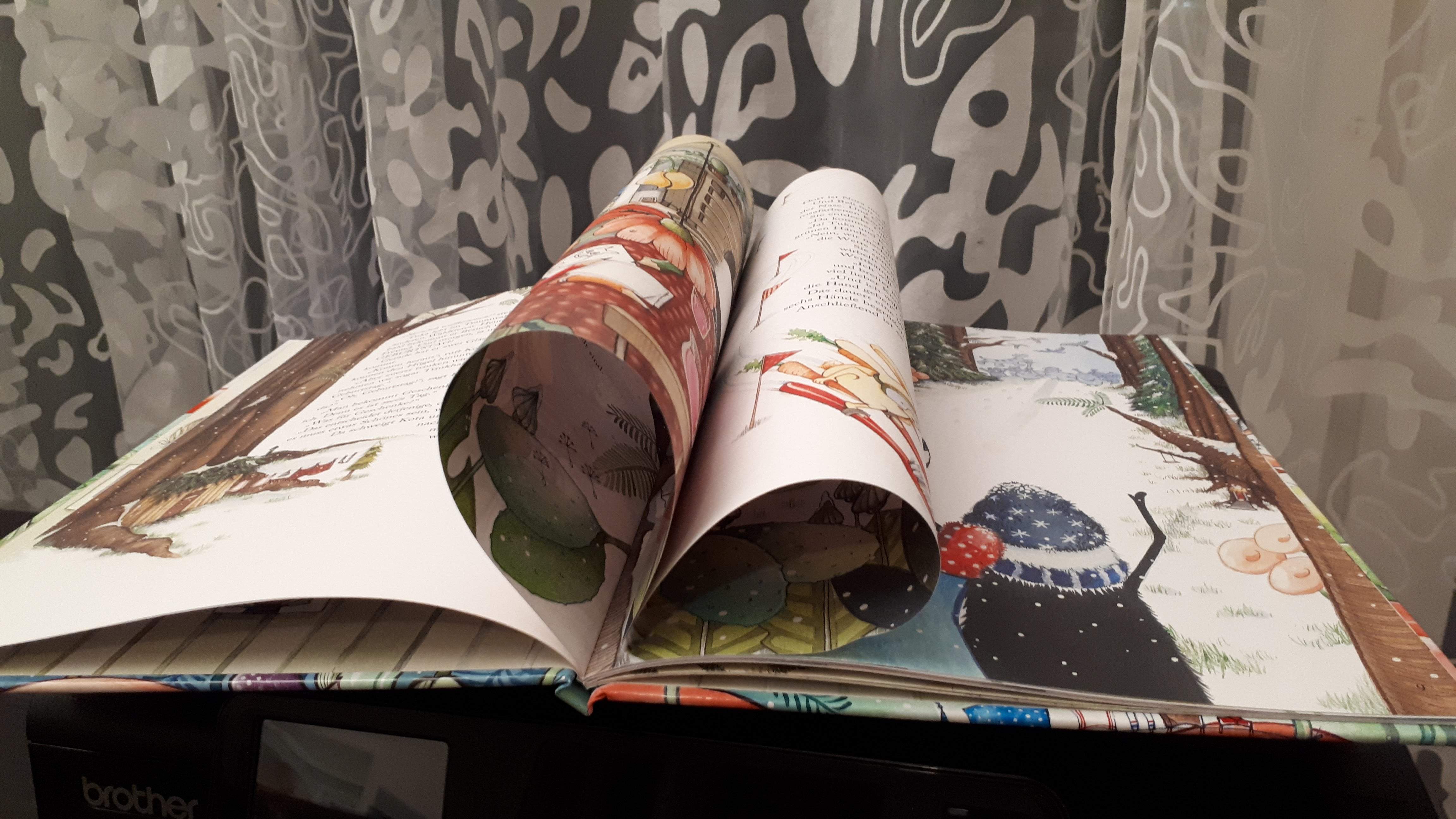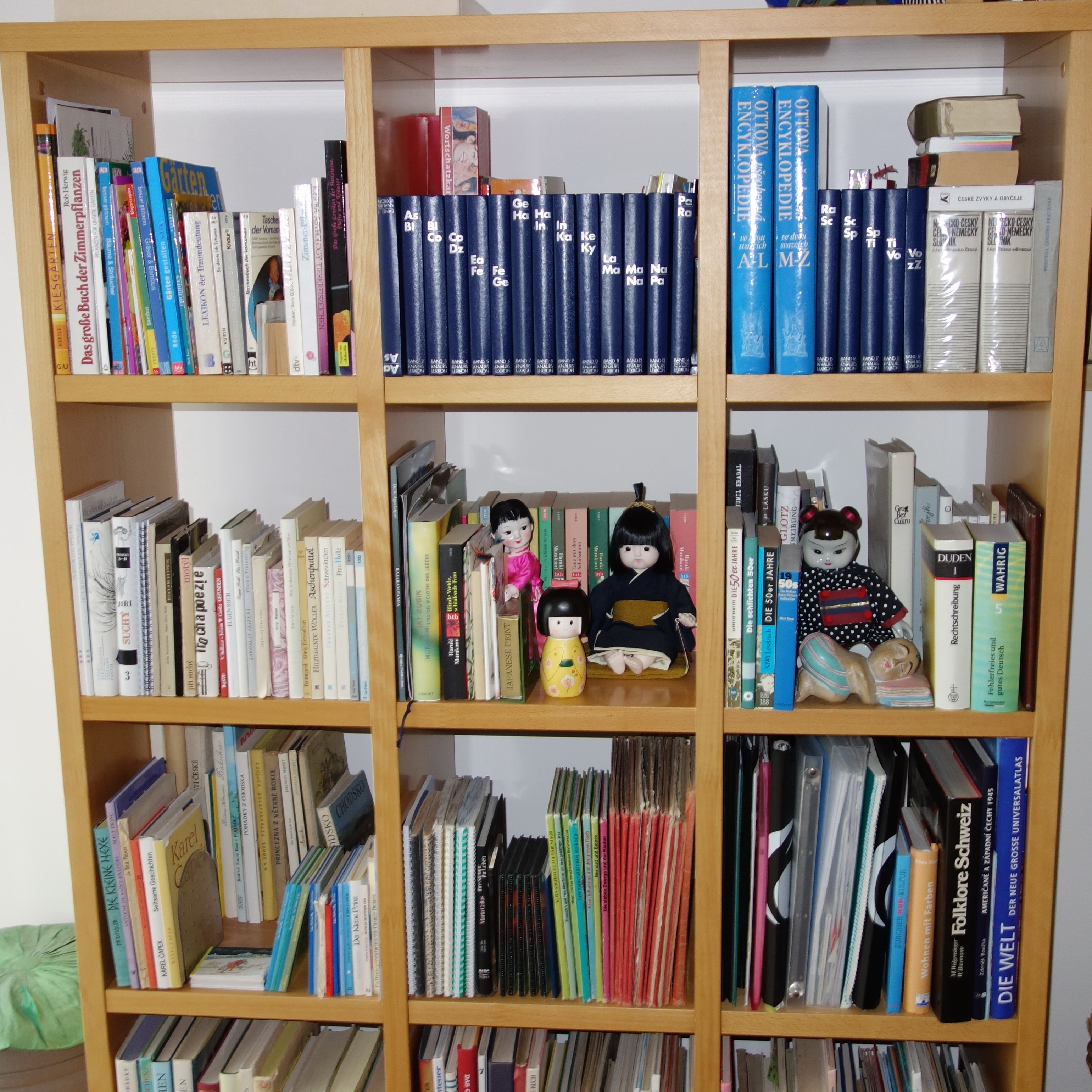Lesen
Wir lesen als Nächstes «Sich lichtende Nebel» von Christian Haller.
Kontakt: Susanne Lehmann, su.le@bluewin.ch
Gelesen und besprochen
Ein geschätzter Freund aus der Kindheit entpuppt sich als Nazi und Mitglied der SS, ein blindwütiger Mörder als lebenslang Leidender am Verlust des Vaters und der Schwester.
Fabrizio Collini im Roman
«Der Fall Collini»
von Ferdinand Schirach hat sich nie etwas zuschulden kommen lassen, er wartet sein Leben lang darauf, sich an demjenigen zu rächen, der den Tod seiner beiden Angehörigen zu verantworten hat.
Sein Pflichtverteidiger Caspar Leinen übernimmt eine schwere Aufgabe, kannte er doch den Ermordeten, SS-Sturmbannführer Hans Meyer, als Grossvater seines besten Freundes. Von seiner Vergangenheit wusste er nichts.
Ferdinand von Schirach ist ein Meister darin, auch hinter schwersten Verbrechen immer noch den Menschen zu sehen.
Wie gestaltete sich das Leben der Menschen, vor allem der jüdischen Bevölkerung, im Berlin Nazideutschlands in den Fünfzigerjahren?
Cioma Schönhaus erinnert sich in seinem Bericht «Der Passfälscher» an seine erstaunlichen Jugendjahre.
Mit Intelligenz und Einfallsreichtum gelang es ihm, sich der Deportation zu entziehen, er lebte ab 1942 in Berlin im Untergrund. Er hatte eine Ausbildung als Grafiker begonnen und nutzte sein Talent, um Ausweispapiere zu fälschen. So verhalf er hunderten von Menschen zur Flucht und rettete sie vor dem Tod. Dank dem verdienten Geld konnte er sich ein unauffälliges Leben leisten. Mit der Hilfe ihm zugewandter Menschen, glücklicher Zufälle und seiner einnehmenden Wesensart gelang es ihm lange Zeit, sich den Fängen der Gestapo zu entziehen. Schliesslich kam ihm diese doch auf die Spur, er wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Mit selbstverständlich von ihm gefälschten Papieren und einer guten Portion Verwegenheit gelang ihm 1943 per Velo die Flucht in die Schweiz. Seine gesamte Familie und viele Freunde wurden deportiert und kehrten nicht zurück.
Cioma Schönhaus hatte ein eigenes Atelier für Grafik und Kommunikation und lebte in der Schweiz. Bis ins hohe Alter hielt er Vorträge gegen das Vergessen.
Einen "passenden Mieter" zu finden, erweist sich im Roman von Lukas Hartmann als trügerisches Unterfangen: Der vor allem von seiner Mutter übermässig behütete Sohn Sebastian zieht aus der Einliegerwohnung im Elternhaus aus. Die Mutter Margret lässt ihn nur ungern und sehr besorgt gehen, während der Vater Gerhard gelassen bleibt. Auf Drängen ihres Mannes sucht Margret einen passenden Mieter für die nun leere Wohnung, obwohl sie diese lieber selbst nutzen möchte.
Aus den vielen Zuschriften, die das Ehepaar erhält, rührt die fehlerhafte und ungeschickte Bewerbung eines jungen Velomechanikers Margrets Herz. Bald darauf bezieht der seltsam unzugängliche und zurückhaltende Beat die ehemalige Wohnung von Sebastian.
Während in der Stadt Überfälle auf junge Frauen zunehmen, kommt bei Margret ein schlimmer Verdacht auf.
Im Zuge der nachfolgenden turbulenten Ereignisse machen sich jahrelang verdrängte Probleme der Familie immer stärker bemerkbar.
Das dürfte einem gestandenen Gentleman wie Henry Preston Standish niemals passieren --- einfach so, am 13. Tag einer Schiffsreise, frühmorgens von Bord eines Frachters ins Meer und damit aus der Welt zu fallen.
In seinem Roman «Gentleman über Bord» erzählt Herbert Clyde Lewis, wie es zum Sturz des Gentleman kommen konnte, und warum dies auf dem Schiff stundenlang niemand bemerkte.
Banale Kleinigkeiten, Unterlassungen und ein fataler Irrtum führten dazu, dass Mr. Standish einen ganzen Tag lang nicht wirklich vermisst wurde. Viel zu spät, mitten in der Nacht, leitete der Kapitän eine Suchaktion ein, die von vornherein aussichtslos war.
Mit grossem Einfühlungsvermögen schildert der Schriftsteller den Überlebenskampf des Henry Preston Standish und die Reaktionen der Schiffspassagiere und der Besatzung auf sein Verschwinden.
Eine Frau klingelt bei ihrem Nachbarn, um ihm einen ungewöhnlichen Vorschlag zu machen. So beginnt der Roman «Unsere Seelen bei Nacht» von Kent Harif. Beide haben ihre Lebenspartner verloren und leben allein in ihren zu gross gewordenen Häusern. Das Ansinnen der Frau, Addie, ist mutig. Sie möchte, dass ihr Nachbar Louis hin und wieder bei ihr übernachtet, um mit jemandem reden zu können. Louis ist einverstanden und so kommt es, dass sie Nacht für Nacht nebeneinander liegen und sich ihr Leben erzählen - sehr zum Missfallen der Anwohner und vor allem Addies Sohn Gene, der um sein Erbe fürchtet.
Obwohl Addie nach einem Unfall in eine Altersinstitution in der Nähe ihres Sohnes ziehen muss, halten die beiden ihre Beziehung aufrecht, allen Hindernissen zum Trotz.
Das Leben in einer Grossstadt kann aufreibend sein. Am Beispiel eines Viertels in Madrid beschreibt Almudena Grandes in ihrem Roman «Kleine Helden» die vielfältigen Probleme der Bevölkerung.
Es herrscht Krisenstimmung, die Leute verlieren ihre Arbeit, ihre Wohnung, stehen oft plötzlich auf der Strasse. Jedoch ist die Hilfsbereitschaft gross: Leerstehende Häuser werden besetzt, um Unterkünfte zu beschaffen, Anwälte beraten Hilfesuchende, Mittagstische für Kinder und bedürftige Familien werden organisiert. Als das Gesundheitszentrum aus Spargründen geschlossen werden soll, reagieren die Quartierbewohner mit einer Grossdemonstration.
Trotz Rückschlägen werden für verarmte Menschen immer wieder kreative Lösungen gefunden.
Auf den Besitz der
«Casa Conti» im Roman von Aline Valangin glauben etliche Bewohner eines kleinen
Bergdorfes Anspruch zu haben. Die Schriftstellerin beschreibt anschaulich das
Leben, die Schwierigkeiten und Sorgen der Menschen im durch die
Industrialisierung verarmten Onsernonetal. Erbschaften und Heiraten sind immer
wieder Grund für Streit und Neid.
Der hochverschuldete Ehemann einer der beiden zukünftigen Erbinnen der Casa verspricht das Haus ihres noch lebenden Vaters einem Freund, der ihm viel Geld geliehen hat. So will er seine Schulden tilgen. Die eigentlichen Erbinnen, zwei Schwestern, sind, nach dem Tod ihres Vaters, aus begreiflichen Gründen mit diesen Absichten nicht einverstanden.
Rechtsanwalt Conti, einem Nachfahren der einstigen Besitzer der Casa gelingt es, die verfahrene Situation zu einem guten Ende zu bringen.
In seinem Roman «Melody» macht Martin Suter das Verschwinden
einer jungen Frau zum Thema: Dr. Stotz, graue Eminenz und einst Politiker, hat
nicht mehr lange zu leben. Er beauftragt den angehenden Anwalt Tom Elmer,
seinen Nachlass in für ihn "positivem Sinne" zu ordnen. Zudem erzählt
er ihm in langen Gesprächen von seiner vergeblichen Suche nach seiner
Verlobten, die vor vierzig Jahren ein paar Tage vor ihrer Hochzeit verschwunden
ist.
Nach dem Tod von Dr. Stotz beginnt Tom, zusammen mit der Nichte
des Verstorbenen, nach Lebenszeichen von Melody zu suchen. Irgendwann meldet
sich der ehemalige Butler von Dr. Stotz bei Tom: Er hat damals, kurz vor der
Hochzeit von Melody und Dr. Stotz, eine aufschlussreiche Beobachtung gemacht.
Aber selbst jetzt bleibt Tom die Wahrheit über das wirkliche Leben von Melody
verborgen.
«Stay away from Gretchen» war der Befehl an die amerikanischen Besatzer im Nachkriegsdeutschland, sich von den deutschen Frauen fernzuhalten. In ihrem gleichnamigen Roman beschäftigt sich die Schriftstellerin Susanne Abel mit der Geschichte der "Brown Babys" und ihrer Mütter.
Ein Sohn beginnt, sich für die Vergangenheit seiner dementen Mutter zu interessieren, als diese sich unverhofft an Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg erinnert. Doch als er ihr das Foto eines kleinen braunen Mädchens zeigt, das er bei ihren Sachen gefunden hat, zieht sie sich wieder ins Vergessen zurück.
Ihr Schicksal ist das vieler deutscher Frauen und ihrer Verbindung zu afroamerikanischen GIs. Die aus diesen Beziehungen entstandenen Kinder wurden den Frauen oft weggenommen und in Heime gebracht, die Frauen diskriminiert und von den Behörden schikaniert. Dieses traurige und verschwiegene Thema wurde bis jetzt nie richtig aufgearbeitet.
Im auf wahren Begebenheiten basierenden Roman «Der Magier im Kreml» von Giuliano da Empoli gibt Putins fiktiver Berater Wadim Baranow Einblick ins Zentrum der russischen Macht in den Jahren vor dem Überfall auf die Ukraine 2022.
Baranow führt die Anordnungen und Befehle Putins aus, vorerst ohne sie zu hinterfragen, die Konsequenzen tragen andere. Doch immer öfter melden sich Zweifel, Baranow realisiert, wie Putin Menschen manipuliert und gnadenlos eliminiert, wenn er keine Verwendung mehr für sie hat. Er kommt einem erzwungenen Abgang zuvor und zieht sich rechtzeitig aus seiner Tätigkeit zurück.
"Dazugehören hat immer seinen Preis", und dazugehören
wollen im Roman der Schweizer Schriftstellerin Rebekka Salm «Die Dinge beim
Namen» alle Bewohner eines kleinen Dorfes im Jura. Dort machen Gerüchte,
Vermutungen und Unwahrheiten die Runde, verschiedene mehr oder weniger
Beteiligte schildern ihre Wahrnehmungen aus eigener Sicht. Einige beobachten,
alle wissen etwas, haben etwas gesehen, niemand spricht darüber, schon gar
nicht mit den Betroffenen.
Die erstaunliche Wahrheit kennen nur zwei Menschen, und diese
schweigen. Rebekka Salm überlässt es den Lesenden, eigene Schlüsse zu ziehen
und die Tatsachen selbst herauszufinden. Auch sie verzichtet letztlich darauf,
die Dinge beim Namen zu nennen.
Im Roman «Matto regiert» von Friedrich Glauser laufen die
Ermittlungen des Wachtmeisters Studer nicht optimal. Viel zu viele Personen
scheinen an der Ermordung des Direktors einer Irrenanstalt im Kanton Bern
beteiligt. Das Motiv und die wirkliche Todesursache sind zunächst unklar. Erst
Laduner, der Nachfolger des toten Direktors, bringt Licht in diesen
verwirrenden Fall und klärt den Irrtum des Wachtmeisters auf.
Laduner gelingt es auch, in seinem eigenen Interesse, seine
Experimente an unheilbar Kranken zu verharmlosen. Frustriert muss Studer die
offensichtlichen Tatsachen akzeptieren.
Die Originalausgabe des Romans mit den vielen berndeutschen
Passagen fand grossen Anklang.
In ihrem Roman «Aufbrechen» schildert die afrikanische
Schriftstellerin Tsitsi Dangarembga die Kindheit und Jugend des Mädchens Tambu
in Simbabwe. Das Leben der afrikanischen Familien wird von patriarchalischen
und kulturellen Zwängen und Bräuchen bestimmt. Väter und höher gestellte
männliche Verwandte verlangen Gehorsam von Kindern und Frauen und bestimmen
deren persönliche Entfaltung. Andererseits wird erwartet, dass Männer mit einem
höheren Einkommen für finanzielle Unterstützung und Schulung der ganzen Grossfamilie
aufkommen.
Da ihr Bruder, der einst die Rolle des Unterstützers von einem
Onkel übernehmen sollte, früh stirbt, erhält Tambu die Möglichkeit, eine
Missionsschule und später ein Internat zu besuchen. Dank dieser Ausbildung, so
erwartet ihr Onkel, wird sie in ein paar Jahren in der Lage sein, für ihre
Familie zu sorgen. Sich in der Welt der "Weissen" zurechtzufinden
wird für Tambu allerdings zu einer Gratwanderung.
In seinem Roman «Der Rote Diamant» bringt Thomas Hürlimann
gekonnt eigene biografische Erinnerungen und historische Ereignisse in einem
turbulenten "Krimi" zusammen:
Im Klosterinternat "Maria zum Schnee" machen sich die
vom eintönigen Klosterleben gelangweilten Zöglinge auf die Suche nach dem
legendären, aber verschollenen "Roten Diamanten" aus dem Kronschatz
des Habsburger Kaisers Karl I. Ein Gerücht besagt, dass er irgendwo in den
unüberschaubaren Gewölben des Klosters versteckt sein soll. Nach vielen
Irrwegen und Enttäuschungen nehmen die abenteuerlichen Nachforschungen ein
unverhofftes und überraschendes Ende.
Den "Florentiner" genannten Diamanten gab es wirklich.
Er war aber gelb, ausserordentlich wertvoll und gilt auch heute noch als
verschollen.
Ihr Schicksal ist das vieler deutscher Frauen und ihrer Verbindung zu afroamerikanischen GIs. Die aus diesen Beziehungen entstandenen Kinder wurden den Frauen oft weggenommen und in Heime gebracht, die Frauen diskriminiert und von den Behörden schikaniert. Dieses traurige und verschwiegene Thema wurde bis jetzt nie richtig aufgearbeitet.
Baranow führt die Anordnungen und Befehle Putins aus, vorerst ohne sie zu hinterfragen, die Konsequenzen tragen andere. Doch immer öfter melden sich Zweifel, Baranow realisiert, wie Putin Menschen manipuliert und gnadenlos eliminiert, wenn er keine Verwendung mehr für sie hat. Er kommt einem erzwungenen Abgang zuvor und zieht sich rechtzeitig aus seiner Tätigkeit zurück.
Die erstaunliche Wahrheit kennen nur zwei Menschen, und diese schweigen. Rebekka Salm überlässt es den Lesenden, eigene Schlüsse zu ziehen und die Tatsachen selbst herauszufinden. Auch sie verzichtet letztlich darauf, die Dinge beim Namen zu nennen.
Die Originalausgabe des Romans mit den vielen berndeutschen Passagen fand grossen Anklang.
Da ihr Bruder, der einst die Rolle des Unterstützers von einem Onkel übernehmen sollte, früh stirbt, erhält Tambu die Möglichkeit, eine Missionsschule und später ein Internat zu besuchen. Dank dieser Ausbildung, so erwartet ihr Onkel, wird sie in ein paar Jahren in der Lage sein, für ihre Familie zu sorgen. Sich in der Welt der "Weissen" zurechtzufinden wird für Tambu allerdings zu einer Gratwanderung.
Im Klosterinternat "Maria zum Schnee" machen sich die vom eintönigen Klosterleben gelangweilten Zöglinge auf die Suche nach dem legendären, aber verschollenen "Roten Diamanten" aus dem Kronschatz des Habsburger Kaisers Karl I. Ein Gerücht besagt, dass er irgendwo in den unüberschaubaren Gewölben des Klosters versteckt sein soll. Nach vielen Irrwegen und Enttäuschungen nehmen die abenteuerlichen Nachforschungen ein unverhofftes und überraschendes Ende.
Den "Florentiner" genannten Diamanten gab es wirklich. Er war aber gelb, ausserordentlich wertvoll und gilt auch heute noch als verschollen.
In seinem Roman «Müll» greift Wolf Haas ein Tabuthema unserer Zeit auf, die Problematik der Organspende und der Organmafia:
Der Altglaslaster einer Mülldeponie fährt ungebremst in einen See und versinkt langsam. Glitzernde Glasscherben überschwemmen das Wasser und bringen die Menschen am Ufer zum Staunen. Der Fahrer dieses Lastwagens war Organisator eines Organhandels, nicht aus Geldgier, sondern weil er glaubte, eine Schuld begleichen zu müssen. Der ehemalige Polizeibeamte und jetzige Müllmann Brenner geht den Vorgängen, die zu diesem Selbstmord führten, erfolgreich nach.
Mit seinem charakteristischen Schreibstil gelingt es dem Schriftsteller, die Brisanz seines Themas zu betonen und zum Nachdenken anzuregen.
Albanien, vergessene Region Europas, ein kleines Land, von dem
wir auch heute kaum etwas wissen.
Lea Ypi schreibt in ihrem Buch «Frei, Erwachsen werden am Ende der
Geschichte» über ihre Kindheit im poststalinistischen Albanien und die
tiefgreifenden Veränderungen nach dem Fall der Mauer.
Im Glauben, bis jetzt in Freiheit gelebt zu haben, stellt sie
schon als Kind verwirrt fest, was "Freiheit", ausser wählen zu
können, noch bedeuten kann: ruinierte Wirtschaft, Arbeitslosigkeit und Chaos.
Zehntausende Menschen fliehen panisch auf überfüllten Schiffen nach Italien und
Griechenland. Viele kehren desillusioniert zurück, andere nie wieder.
Auch Lea Ypi wendet sich ab von ihrem Heimatland, für immer.
Für Elisabeth Zott im Buch von Bonnie Garmus ist vieles im Leben vor allem «Eine Frage der Chemie».
Leider wird sie von ihren Berufskollegen im Forschungsinstitut Hasting als Frau und Chemikerin diskriminiert und kann nur als Laborassistentin arbeiten. Sie verliebt sich in ihren erfolgreichen Arbeitskollegen Calvin Evans, der als einziger ihre Fähigkeiten erkennt.
Nach seinem plötzlichen Unfalltod verliert sie, weil schwanger, ihre Stelle, ein übliches Vorgehen in den 50-er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Sie schlägt sich vorerst mit dem Beraten ehemaliger Arbeitskollegen durch und erhält etwas später das Angebot, die Nachmittagssendung "Essen um sechs" im Fernsehen zu übernehmen.
Diese Kochsendung, die Elisabeth Zott ebenfalls als Frage der Chemie begreift und ihre Rezepte auf wissenschaftlicher Basis vermittelt, wird zum Hit bei ihrem vorwiegend weiblichen Publikum, das sie dazu aufruft, nicht nur das Kochen, sondern das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Der Roman nimmt ein glückliches Ende, Elisabeth Zott kann später die Firma Hasting als leitende Chefin übernehmen.
Die Diskussion zum Buch «43'586, ein Schweizer Decamerone» verlief für
einmal etwas anders, weil der Verfasser, Ralf Schlatter am Treffen teilnahm. Es
war eine besondere Erfahrung, den Schriftsteller eines unserer Buchfavoriten
kennen zu lernen.
In diesem "Schweizer Decamerone" träumt der Erzähler
davon, wie er, auf einer einsamen Insel gestrandet, fünf Leidensgenossen eine
Geschichte erzählt: von elf Menschen, die wiederum einer sterbenden Frau sieben
Tage lang an jedem dieser Tage je eine Geschichte erzählen. Siebenundsiebzig
Geschichten, die das gesamte Spektrum menschlichen Lebens und Sterbens
berühren! Da werden humor- und liebevoll Alltagssituationen geschildert, banale
Ereignisse genauso wie fantastische, unwahrscheinliche. Am Schluss gehen dem
Erzähler die Worte aus und er erwacht abrupt mitten in einem Satz.
Bei «Das rote Adressbuch» von Sofia Lundberg war sich die
Gruppe einig: Die Erinnerungen eines bewegten Lebens anhand der Einträge im
Adressbuch zu erzählen, ist als Idee interessant. Die Ausführung indessen
fanden wir zu romantisch und überladen mit zu vielen, teilweise
unwahrscheinlich scheinenden Ereignissen. Schade!
«Sie kam aus Mariupol», Jewgenia, die Mutter der
Schriftstellerin Natascha Wodin, und wurde nur 36 Jahre alt.
Dieser Roman beschreibt die Suche Natascha Wodins nach der
Vergangenheit und dem Leben ihrer Mutter, um so eine Erklärung für ihren Suizid
zu finden. Hilfe erhält sie zunächst von einem Genealogen der "Asov's
Greeks", einer Organisation in Mariupol, die Menschen bei der Suche nach
Angehörigen unterstützt. Die Stadt war früher stark von der griechischen Kultur
geprägt.
Nach und nach erschliessen sich Natascha Wodin völlig überraschend
ihr unbekannte weitläufige Verwandtschaftsbeziehungen. Ihre Mutter entstammte
einer ehemals vermögenden Familie, die von Stalin enteignet wurde. Sie selbst
wurde später mit ihrem Mann als "Ostarbeiterin" nach Nazideutschland
deportiert. Natascha Wodin lebte als Kind mit ihren Eltern in einem Lager bei
Nürnberg. Später konnte die Familie in eine eigene Wohnung umziehen.
Jewgenia Wodin sprach nie über ihre Herkunft und nahm sich mit 36
Jahren das Leben.
In ihrem Roman «Annette, ein Heldinnenepos» beschreibt die
Schriftstellerin Anne Weber das rastlose und turbulente Leben der heute
97-jährigen Anne Beaumanoir.
Schon mit 19 Jahren arbeitet Annette als Befehlsempfängerin,
"Kofferträgerin" für die kommunistische Résistance Frankreichs.
Gleichzeitig studiert sie Medizin in Rennes und Paris. 1946 heiratet sie,
bekommt zwei Kinder und führt als Ärztin ein bürgerliches Leben.
Doch 1954, nach Ferien in Algerien, geht sie in den Widerstand
gegen die französische Herrschaft in Algerien. Ihre Kinder werden von einem
befreundeten Ehepaar aufgezogen, da ihr Ehemann ebenfalls im Widerstand
arbeitet. Annette wird wiederum "Kofferträgerin", diesmal für den
FLN. Sie wird verhaftet und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Es gelingt ihr
nach Tunis zu fliehen, später nach Algerien, wo sie Teil der Regierung unter
Ben Bella wird.
Immer wieder überkommen sie Zweifel am Sinn ihrer Arbeit, aber sie
macht weiter, will nichts hinterfragen. Nach Ablauf ihrer Gefängnisstrafe wird
sie begnadigt und kann nach Frankreich zurückkehren, doch den Kontakt zu ihren
Kindern hat sie verloren.
Khaled Hosseini vermittelt mit seinem Roman
"Traumsammler" einen Einblick in die schwierigen Lebensbedingungen
der Menschen in Afghanistan. Aus unterschiedlichen Perspektiven wird das Leben
zweier Geschwister erzählt, die in früher Kindheit abrupt getrennt wurden.
Wie damals alltäglich, und nicht nur in Afghanistan, gaben arme
Familien eines ihrer Kinder an begüterte, kinderlose Ehepaare, um mit deren
Zuwendungen ihre eigene Existenz und die ihrer anderen Kinder ein wenig zu verbessern.
Pari, das dreijährige Mädchen, vergisst, was in ihrer Kindheit
geschehen ist, im Gegensatz zu ihrem damals zehnjährigen Bruder Abdullah, der
ein Leben lang unter dem Verlust der Schwester leidet.
Erst Jahrzehnte später erhält Pari den Brief ihres verstorbenen
Stiefonkels, in dem er schildert, was ihr als kleines Kind widerfahren ist. Sie
findet Abdullah zwar, dieser aber ist schwer an Demenz erkrankt und erinnert
sich nicht mehr an seine Schwester. Zum Glück lernt Pari ihre gleichnamige Nichte
kennen, die Abdullah jahrelang gepflegt hat.
Der «Fallmeister» Christoph Ransmayrs zeigt uns eine utopische,
in Kleinstaaten zerfallene und von Syndikaten regierte Erde. Um die
Beherrschung des Wassers an Flüssen, Dämmen und Seen entstehen Kriege,
Süsswasser wird zum wichtigsten Rohstoff.
In jener fremden Welt irrt ein Sohn durch den kontinentalen
Flickenteppich des alten Europa auf der Suche nach seinem verschwundenen Vater,
dem Fallmeister. Dieser wird wegen einer vermutlich falschen Manipulation beim
Öffnen und Schliessen von Schleusen für den Tod von fünf Menschen
verantwortlich gemacht.
Der Sohn ist als Hydrotechniker systemrelevant und erhält deshalb
die Erlaubnis der Syndikate zu reisen. So gelingt es ihm, seinen Vater zu
finden und eine überraschende Entdeckung zu machen.
Der Roman «Das Sandkorn» von Christoph Poschenrieder führt uns
in die Zeit vor Beginn des Ersten Weltkriegs.
In Berlin wird ein Bürger vorsorglich festgenommen. Sein Vergehen:
das Verstreuen von Sand in den Strassen der Stadt. Das ist zwar nicht verboten,
macht ihn aber in den Augen der Obrigkeit verdächtig, ganz besonders in Zeiten
eines absehbaren Krieges. Der zuständige Kommissar interessiert sich zunehmend
für das rätselhafte Verhalten des Mannes und lässt sich in langen Stunden seine
Geschichte erzählen: die Geschichte dreier Forschungsreisenden im Auftrag
Kaiser Wilhelms II. durch Italien, um Bauwerke des Stauferkönigs Friedrich II.
zu untersuchen. Dieser Bestandesaufnahme wie auch der schwierigen Beziehung der
drei Reisenden, einer Frau und zwei Männer, setzt der Ausbruch des Ersten
Weltkriegs ein jähes Ende.
Eine Karriere wie die des «Munzinger Pascha» im Roman von Alex Capus wäre in der heutigen Welt für einen Schweizer nicht mehr möglich: zwanzigjährig reist Werner Munzinger, Sohn des Bundesrats und ersten Bundespräsidenten der Schweiz Josef Munzinger, für einen Sprachaufenthalt nach Kairo. Er spricht fliessend Arabisch und Hebräisch.
Ein Jahr später ist er unterwegs auf dem Roten Meer, im Auftrag einer französischen Handelsfirma soll er nach günstigen Geschäften Ausschau halten.
Im Hochland Abessiniens schliesslich lässt er sich nieder, heiratet, treibt Handel und besitzt Vieh und fruchtbaren Boden. Er ist wohlhabend und respektiert im ganzen Land. Seine Forschungsarbeiten sind auch in der Schweiz bekannt und werden in der Presse (z.B. der «NZZ») besprochen.
1871 wird Werner Munzinger, nun 39 Jahre alt, zum Gouverneur von Massaua und den Provinzen am Roten Meer ernannt. Er regiert über zwei Millionen Menschen in einem Gebiet drei Mal so gross wie die Schweiz. Viele europäische Einwanderer stranden in seinem Reich. Er setzt sich für eine bessere Behandlung der Sklaven ein, will Schulen und Spitäler bauen. Er verbindet Massaua über einen Damm mit dem Festland. Dieser Damm steht heute noch.
Im November 1875, während einer Expedition, kommen Werner Munzinger und seine Frau bei einer Schiesserei ums Leben.
Der Roman «Mauersegler» von Christoph Poschenrieder dreht sich um fünf ehemalige Schulkameraden, die im Alter zusammen eine Wohngemeinschaft gründen. Wie ein Schatten begleitet sie stets der sechste ihrer damaligen Clique, dessen Tod sie als Kinder mitverschuldet haben.
Mit einem komplizierten digitalen System sichern sich die fünf Herren gegenseitig ab, sie wollen selbst über ihr Lebensende bestimmen. Zusätzlich engagieren sie eine Betreuerin, Katharina aus dem Osten Europas. Diese kümmert sich umsichtig und aufmerksam um die fünf, und sie hat einen Plan: Jeweils nach einem Heimaturlaub kehrt sie mit einem Waisenkind zurück und bringt dieses im weitläufigen Haus der Pensionäre unter. Für diese bedeuten die Kinder Leben und Abwechslung.
Nach dem Tod der fünf Freunde wird das Haus zu einem Zufluchtsort für elternlose Kinder.
Der Roman "Justiz" von Friedrich Dürrenmatt gab in Sachen
Rechtsverständnis viel zu reden:
Ein junger, mittelloser Anwalt erhält aus dem Gefängnis heraus
vom Mörder eines Professors der Universität Zürich den Auftrag zu untersuchen,
ob nicht ein anderer der Täter gewesen sein könnte. Er nimmt des Geldes wegen
an, obwohl die Voraussetzungen nicht erfolgversprechend scheinen. Das
eigentlich aussichtslose Unternehmen führt dazu, dass schliesslich der
wirkliche Mörder, obwohl bei der Tat von vielen Menschen beobachtet, freigesprochen
wird. Der Tatverdacht wird auf einen Rivalen des Ermordeten gelenkt, der sich
das Leben genommen hatte. Unterstellungen, Intrigen, Vermutungen und ein
raffinierter Strafverteidiger bringen das Geschworenengericht in der
Revisionsverhandlung dazu, das alte Urteil für ungültig zu erklären. Der echte
Mörder wird, wider besseres Wissen, rehabilitiert.
Der anfangs beauftragte Anwalt beschliesst darauf, um der
"Gerechtigkeit" willen, den wirklichen Täter zu erschiessen.
«Ich bleibe hier» von Marco Balzano beschreibt die
Schicksale der Menschen im kleinen Dorf Graun im Vinschgau. Sie widerspiegeln
die wechselvolle Geschichte des Südtirols im und nach dem zweiten Weltkrieg und
die Macht grosser Konzerne, die keine Rücksicht nehmen auf Land und Leute.
Kaum hat sich die Bevölkerung von Graun und Reschen von den
Wirren des Krieges etwas erholt, werden ihre Dörfer am Reschensee von politischen
und wirtschaftlichen Interessen eingeholt. Sie sollen zu Gunsten eines Stausees
geflutet und die Bewohner umgesiedelt werden. Kein Widerstand, nicht einmal der
Appell an den Papst, kann die brutalen Ereignisse aufhalten.
Heute zeugt nur noch der aus dem Wasser des Stausees ragende
Kirchturm von Graun davon, dass hier einmal Menschen gelebt und ihr Land bestellt
haben, ein blühendes Bergdorf bestanden hat.
In "Die Annonce" von Marie-Helene Lafon will eine
Frau, Annette, nach einer gescheiterten Ehe, zusammen mit ihrem kleinen Sohn
ein neues Leben suchen, weit ab vom alten, so weit wie nur möglich. Selbst an
der Grenze zu Belgien lebend, beantwortet sie die Annonce eines Bauern, Paul,
und zieht zu ihm ins Zentralmassiv Frankreichs. Behutsam betritt sie die
festgefügte Gemeinschaft einer Familie, arrangiert sich mit zwei alten Onkeln
und der resoluten Schwester Pauls. Auch ihr Sohn Eric findet, mit Hilfe der
Hündin Lola, seinen Platz und freundet sich mit Paul an. Paul schlichtet sanft
und freundlich unausgesprochene Vorurteile und Streitigkeiten und setzt sich zu
Gunsten Annettes durch.
In dichter, bildhafter Sprache schildert die Autorin die
sich langsam festigende Beziehung von Paul und Annette und das bäuerliche Leben
in der kargen Landschaft des Cantals.
Lea Ypi schreibt in ihrem Buch «Frei, Erwachsen werden am Ende der Geschichte» über ihre Kindheit im poststalinistischen Albanien und die tiefgreifenden Veränderungen nach dem Fall der Mauer.
Im Glauben, bis jetzt in Freiheit gelebt zu haben, stellt sie schon als Kind verwirrt fest, was "Freiheit", ausser wählen zu können, noch bedeuten kann: ruinierte Wirtschaft, Arbeitslosigkeit und Chaos. Zehntausende Menschen fliehen panisch auf überfüllten Schiffen nach Italien und Griechenland. Viele kehren desillusioniert zurück, andere nie wieder.
Nach seinem plötzlichen Unfalltod verliert sie, weil schwanger, ihre Stelle, ein übliches Vorgehen in den 50-er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Sie schlägt sich vorerst mit dem Beraten ehemaliger Arbeitskollegen durch und erhält etwas später das Angebot, die Nachmittagssendung "Essen um sechs" im Fernsehen zu übernehmen.
Diese Kochsendung, die Elisabeth Zott ebenfalls als Frage der Chemie begreift und ihre Rezepte auf wissenschaftlicher Basis vermittelt, wird zum Hit bei ihrem vorwiegend weiblichen Publikum, das sie dazu aufruft, nicht nur das Kochen, sondern das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Der Roman nimmt ein glückliches Ende, Elisabeth Zott kann später die Firma Hasting als leitende Chefin übernehmen.
Dieser Roman beschreibt die Suche Natascha Wodins nach der Vergangenheit und dem Leben ihrer Mutter, um so eine Erklärung für ihren Suizid zu finden. Hilfe erhält sie zunächst von einem Genealogen der "Asov's Greeks", einer Organisation in Mariupol, die Menschen bei der Suche nach Angehörigen unterstützt. Die Stadt war früher stark von der griechischen Kultur geprägt.
Nach und nach erschliessen sich Natascha Wodin völlig überraschend ihr unbekannte weitläufige Verwandtschaftsbeziehungen. Ihre Mutter entstammte einer ehemals vermögenden Familie, die von Stalin enteignet wurde. Sie selbst wurde später mit ihrem Mann als "Ostarbeiterin" nach Nazideutschland deportiert. Natascha Wodin lebte als Kind mit ihren Eltern in einem Lager bei Nürnberg. Später konnte die Familie in eine eigene Wohnung umziehen.
Jewgenia Wodin sprach nie über ihre Herkunft und nahm sich mit 36 Jahren das Leben.
Doch 1954, nach Ferien in Algerien, geht sie in den Widerstand gegen die französische Herrschaft in Algerien. Ihre Kinder werden von einem befreundeten Ehepaar aufgezogen, da ihr Ehemann ebenfalls im Widerstand arbeitet. Annette wird wiederum "Kofferträgerin", diesmal für den FLN. Sie wird verhaftet und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Es gelingt ihr nach Tunis zu fliehen, später nach Algerien, wo sie Teil der Regierung unter Ben Bella wird.
Immer wieder überkommen sie Zweifel am Sinn ihrer Arbeit, aber sie macht weiter, will nichts hinterfragen. Nach Ablauf ihrer Gefängnisstrafe wird sie begnadigt und kann nach Frankreich zurückkehren, doch den Kontakt zu ihren Kindern hat sie verloren.
Wie damals alltäglich, und nicht nur in Afghanistan, gaben arme Familien eines ihrer Kinder an begüterte, kinderlose Ehepaare, um mit deren Zuwendungen ihre eigene Existenz und die ihrer anderen Kinder ein wenig zu verbessern.
Pari, das dreijährige Mädchen, vergisst, was in ihrer Kindheit geschehen ist, im Gegensatz zu ihrem damals zehnjährigen Bruder Abdullah, der ein Leben lang unter dem Verlust der Schwester leidet.
Erst Jahrzehnte später erhält Pari den Brief ihres verstorbenen Stiefonkels, in dem er schildert, was ihr als kleines Kind widerfahren ist. Sie findet Abdullah zwar, dieser aber ist schwer an Demenz erkrankt und erinnert sich nicht mehr an seine Schwester. Zum Glück lernt Pari ihre gleichnamige Nichte kennen, die Abdullah jahrelang gepflegt hat.
In jener fremden Welt irrt ein Sohn durch den kontinentalen Flickenteppich des alten Europa auf der Suche nach seinem verschwundenen Vater, dem Fallmeister. Dieser wird wegen einer vermutlich falschen Manipulation beim Öffnen und Schliessen von Schleusen für den Tod von fünf Menschen verantwortlich gemacht.
Der Sohn ist als Hydrotechniker systemrelevant und erhält deshalb die Erlaubnis der Syndikate zu reisen. So gelingt es ihm, seinen Vater zu finden und eine überraschende Entdeckung zu machen.
In Berlin wird ein Bürger vorsorglich festgenommen. Sein Vergehen: das Verstreuen von Sand in den Strassen der Stadt. Das ist zwar nicht verboten, macht ihn aber in den Augen der Obrigkeit verdächtig, ganz besonders in Zeiten eines absehbaren Krieges. Der zuständige Kommissar interessiert sich zunehmend für das rätselhafte Verhalten des Mannes und lässt sich in langen Stunden seine Geschichte erzählen: die Geschichte dreier Forschungsreisenden im Auftrag Kaiser Wilhelms II. durch Italien, um Bauwerke des Stauferkönigs Friedrich II. zu untersuchen. Dieser Bestandesaufnahme wie auch der schwierigen Beziehung der drei Reisenden, einer Frau und zwei Männer, setzt der Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein jähes Ende.
Im Hochland Abessiniens schliesslich lässt er sich nieder, heiratet, treibt Handel und besitzt Vieh und fruchtbaren Boden. Er ist wohlhabend und respektiert im ganzen Land. Seine Forschungsarbeiten sind auch in der Schweiz bekannt und werden in der Presse (z.B. der «NZZ») besprochen.
1871 wird Werner Munzinger, nun 39 Jahre alt, zum Gouverneur von Massaua und den Provinzen am Roten Meer ernannt. Er regiert über zwei Millionen Menschen in einem Gebiet drei Mal so gross wie die Schweiz. Viele europäische Einwanderer stranden in seinem Reich. Er setzt sich für eine bessere Behandlung der Sklaven ein, will Schulen und Spitäler bauen. Er verbindet Massaua über einen Damm mit dem Festland. Dieser Damm steht heute noch.
Im November 1875, während einer Expedition, kommen Werner Munzinger und seine Frau bei einer Schiesserei ums Leben.
Mit einem komplizierten digitalen System sichern sich die fünf Herren gegenseitig ab, sie wollen selbst über ihr Lebensende bestimmen. Zusätzlich engagieren sie eine Betreuerin, Katharina aus dem Osten Europas. Diese kümmert sich umsichtig und aufmerksam um die fünf, und sie hat einen Plan: Jeweils nach einem Heimaturlaub kehrt sie mit einem Waisenkind zurück und bringt dieses im weitläufigen Haus der Pensionäre unter. Für diese bedeuten die Kinder Leben und Abwechslung.
Nach dem Tod der fünf Freunde wird das Haus zu einem Zufluchtsort für elternlose Kinder.
Der anfangs beauftragte Anwalt beschliesst darauf, um der "Gerechtigkeit" willen, den wirklichen Täter zu erschiessen.
In Briefen, Mails, Berichten verschiedener Beteiligter schildert
Maria Semple in ihrem Roman "Wo steckst du, Bernadette?" die kuriosen
Ereignisse im Leben von Bernadette Fox, einer unkonventionellen Frau, die durch
ihr etwas abweisend scheinendes Verhalten überall aneckt und auf Ablehnung
stösst. Als Architektin ist sie eine Pionierin der ökologischen Bauweise: alle
von ihr verwendeten Materialien müssen aus dem näheren Umkreis des
Baugrundstücks stammen.
Auf Grund sich häufender unverschuldeter Missverständnisse zieht sich Benadette Fox entmutigt aus der Öffentlichkeit zurück und gibt ihren Beruf auf. Der Elan, das baufällige Haus, in dem sie mit Mann und Tochter lebt zu renovieren, fehlt ihr. Ihren Alltag, von dem sie sich überfordert fühlt, lässt sie sich von einer indischen "Assistentin" online organisieren. Diese wiederum entpuppt sich als russische Agentin, die sie und vor allem ihren Mann, der bei Microsoft arbeitet, ausspioniert. Das FBI wird eingeschaltet und Bernadette Fox für psychiatriereif erklärt. Aber bevor sie zwangsweise in eine Klinik eingewiesen werden soll, verschwindet sie in die Antarktis, wo sie eine neue Herausforderung findet.
Die Handlung dieses Buches ist sicher überzeichnet, doch durch die Gestaltung der unterschiedlichen Texte abwechslungsreich und witzig zu lesen.
Die Schriftstellerin Ann Petry beschreibt in «Die Strasse» das von Armut und Not geprägte Leben einer afroamerikanischen Frau im Harlem der 1940-er Jahre. In der 116th Street, umgeben von Hoffnungslosigkeit, Gewalt und Rassismus versucht die alleinerziehende Mutter für sich und ihren Sohn einen Weg aus dieser Strasse und in eine würdige Existenz zu finden. Wegen ihrer Hautfarbe sieht sie sich immer wieder mit zweideutigen Stellenangeboten konfrontiert, wird diskriminiert und belästigt. Trotz verzweifelter Bemühungen, aus ihrer desolaten Situation herauszufinden, scheitert sie an der Niedertracht der Menschen und der Strasse. Sie bringt sich in eine ausweglose Lage, die sie schliesslich zur Flucht und zum Verlassen ihres Sohnes zwingt.
Ein wenig aus der Zeit gefallen ist Brinkebüll, ein Bauerndorf,
in dem die "Mittagsstunde" heilig ist. Wenn viele Menschen schlafen,
sich Türen leise öffnen und wieder schliessen, wenn sich Erwachsene
unbeobachtet glauben und Kinder allerhand Schabernack treiben.
Brinkebüll hat mit einer "Flurbereinigung" zu kämpfen:
Felder werden zusammengelegt, Bauern müssen ihre Höfe aufgeben, der Dorfladen
geht ein. Bäume werden abgeholzt, Bäche begradigt, die Dorfgemeinschaft leidet.
Und mittendrin spielt die verworrene Familiengeschichte der Feddersens: Ein
Mann, der aus dem Krieg heimkehrt und nicht wirklich willkommen ist und ein
Enkelsohn, der etwas gutzumachen hat.
Der Roman "Mittagsstunde" von Dörte Hansen beschreibt
den stillen Untergang der "guten alten Zeit" und lässt uns
nachdenklich werden.
Simone Lappert beschreibt in ihrem Buch «Der Sprung», wohin ein
fatales Missverständnis, Mediengeilheit und Sensationslust führen können: Wegen
eines panischen Telefonats geht die Polizei ohne nachzufragen davon aus, dass
sich eine junge Frau, die auf einem Balkon ausgesperrt wurde und aufs Dach
eines Hauses gestiegen ist, umbringen will. Presse und Neugierige finden sich
ein, niemand fragt genauer nach, wie es zu dieser Situation hatte kommen
können. Etliche näher Beteiligte sind nur darauf bedacht ihren Ruf zu wahren,
sich zu profilieren oder von den Umständen zu profitieren.
So kommt es, dass eine eigenwillige junge Frau, die anfänglich nur
aus ihrer unfreiwilligen Lage befreit werden wollte, im ausgelegten
Sprungkissen landet und in die Psychiatrie eingeliefert wird. Die Schicksale
und Handlungen verschiedenster Menschen beeinflussen das Geschehen und werden
von der Schriftstellerin gekonnt miteinander in Verbindung gebracht.
Die Romane "Alle, ausser mir" von Francesca Melandri und "Herkunft" von Saša Stanišić haben, bei vollkommen unterschiedlichem Schreibstil, etliche Gemeinsamkeiten: Da sind die Demenzen von Vater oder Grossmutter und die daraus entstehenden Missverständnisse, die Wichtigkeit des familiären Zusammenhalts, Rassismus und Krieg.
Francesca Melandri beschreibt in drastischen Bildern die Kolonialgeschichte Italiens, Krieg und Besetzung im damaligen Abessinien, während Saša Stanišić mit knappen, fast zynischen Äusserungen die Kriege im ehemaligen Jugoslawien und in seiner bosnischen Heimat schildert.
Die Bedeutung der Familie und somit der Herkunft über drei Generationen spielt in beiden Büchern eine zentrale Rolle. Was heisst es, zufällig in ein Land, in eine Familie hinein geboren zu werden? Diese Frage begleitet uns in beiden Werken.
Ein ganz besonderes Buch, für alle, die immer noch mehr lesen möchten: "Das Mädchen mit dem Fingerhut" von Michael Köhlmeier: Eine Parabel über Liebe, Gleichgültigkeit und Verwahrlosung.
Die Romane "Alle, ausser mir" von Francesca Melandri und "Herkunft" von Saša Stanišić haben, bei vollkommen unterschiedlichem Schreibstil, etliche Gemeinsamkeiten: Da sind die Demenzen von Vater oder Grossmutter und die daraus entstehenden Missverständnisse, die Wichtigkeit des familiären Zusammenhalts, Rassismus und Krieg.
Francesca Melandri beschreibt in drastischen Bildern die Kolonialgeschichte Italiens, Krieg und Besetzung im damaligen Abessinien, während Saša Stanišić mit knappen, fast zynischen Äusserungen die Kriege im ehemaligen Jugoslawien und in seiner bosnischen Heimat schildert.
Die Bedeutung der Familie und somit der Herkunft über drei Generationen spielt in beiden Büchern eine zentrale Rolle. Was heisst es, zufällig in ein Land, in eine Familie hinein geboren zu werden? Diese Frage begleitet uns in beiden Werken.
Coronabedingt fand unser Austausch zum Buch «Der Spieler oder Roulettenburg» von Fjodor Dostojewskij diesmal per Mail statt.
Selbst spielsüchtig, beschreibt der Schriftsteller in diesen
Aufzeichnungen den Weg eines jungen Mannes in die Abhängigkeit.
Alexej Iwanowitsch, ein Hauslehrer ohne Vermögen, will seinen
Lebensunterhalt mit Spielen verdienen. Eine regelmässige Arbeit anzunehmen, ist
für ihn keine Option mehr. Vorerst mit Glück gesegnet, gerät er in der
exzentrischen Gesellschaft, die sich um die Roulettetische Europas versammelt,
in Schwierigkeiten. Rücksichtslos und leichtfertig setzt er Liebe,
Freundschaften und seine Zukunft aufs Spiel, bis ihm nichts mehr bleibt, ausser
weiter zu spielen.
Dostojewskij beschreibt die Essenz einer Sucht, der alles, was lebenswert ist, geopfert wird. Die Handlung ist spannend und temporeich geschrieben, zwei ausgezeichnete neue Übersetzungen, (Swetlana Geier und Alexander Nitzberg) stehen zur Verfügung.
Eveline Hasler beschreibt in «Tochter des Geldes» das Leben der
Revolutionärin und Kommunistin Mentona Moser (1874 - 1971). Diese ist
hierzulande weitgehend unbekannt, trotz ihres grossen Einsatzes für
benachteiligte Menschen.
In der Schweiz geboren und aufgewachsen auf der Halbinsel Au, liess sie sich in
London zur Sozialarbeiterin ausbilden und kümmerte sich um Kinder armer
Familien. Nach einem Lehrgang in Krankenpflege gründete sie in Zürich die erste
soziale Frauenschule der Schweiz. Sie trat der Kommunistischen Partei der
Schweiz bei und begann sich für das neue sozialistische Russland zu
interessieren.
Mentona Moser übernahm die Leitung der Mütter- und Säuglingspflege bei Pro
Juventute und trat 1922 nach dem Tod von Rosa Bloch deren Nachfolge an.
1926 reiste sie als Schweizer Delegierte an die 6. Tagung der Kommunistischen
Internationale nach Moskau. In der Nähe Moskaus baute sie später ein Kinderheim
auf.
Ab 1929 lebte sie in Berlin und arbeitete im Geschäft «Arbeiterkult», das Schallplatten mit Texten und Liedern von Brecht, Tucholsky und anderen Autoren verkaufte. Beim Machtantritt der Nazis musste der Laden geschlossen werden.
Nun übernahm sie für die Partei konspirative Arbeiten und Agententätigkeiten. 1933 rettete sie sich in die Schweiz. Mittellos überlebte sie die Kriegsjahre in Zürich.
Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Mentona Moser auf Einladung der DDR in Ostberlin, nun als Bürgerin der DDR. In einem Pionierheim in Berlin wurde sie gepflegt, das Armenhaus in der Schweiz blieb ihr erspart.
«Der Lärm der Zeit» prägte im Roman von Julian Barnes das Leben des
Komponisten Dmitri Schostakowitsch.
Dieser entkam zwar den Säuberungen Stalins, während viele
befreundete Künstler erschossen oder in Lager verbannt wurden. Doch Stalin und
seine Funktionäre zwangen Schostakowitsch mit subtilen Drohungen, gefällige
Musik für die Massen zu schreiben. Man nötigte ihn zu falschen Aussagen und
veröffentlichte in seinem Namen regierungsfreundliche Texte. Seine Werke wurden
abgesetzt und verboten. Erst nach dem Tod Stalins konnten sie allmählich wieder
aufgeführt werden. Die Sowjetunion bediente sich vieler Künstler wie
Schostakowitsch, um sich selbst als human darzustellen. Keiner der Betroffenen
wagte es, auf die Missstände in der UdSSR hinzuweisen.
Zermürbt und resigniert fand Schostakowitsch schliesslich in
passivem Widerstand und Ironie die einzige Möglichkeit für sich, die
Forderungen der Behörden zu ertragen und trotzdem für seine Kunst zu leben,
ohne mit seiner Familie die Heimat verlassen zu müssen oder gar umgebracht zu
werden.
Der Roman «Sturmflut» von Margriet de Moor thematisiert die
Flutkatastrophe 1953 in den Niederlanden, als Folge der jahrzehntelang
vernachlässigten Deichbauten, anhand der Geschichte zweier Schwestern.
Die kontroverse Beziehung der beiden führt dazu, dass sich die
eine, Lidy, überreden lässt, das Patenkind der anderen, Armanda, in einem in
Meeresnähe gelegenen Landesteil zu besuchen. Trotz Sturmwarnung tritt Lidy die
Reise, die schliesslich in den Tod führt, an. Armanda findet sich im Leben
ihrer Schwester wieder, heiratet deren Mann und zieht Lidys Tochter Nadja auf.
Bis an ihr Lebensende fragt sich Armanda, wie ihr eigenes Leben unter anderen
Umständen hätte verlaufen können.
Erstaunt hat uns die ungeheure Naivität und die Gutgläubigkeit, mit der die Menschen damals auf ihr marodes Deichsystem vertrauten. Was geschehen könnte überstieg, trotz Vorwarnung, ihr Vorstellungsvermögen. Informationen konnten nicht weitergegeben werden wegen der ausgefallenen Strom- und Telefonverbindungen. So liess sich das Ausmass der Katastrophe lange nicht erkennen. Die Bevölkerung war sich Überflutungen gewohnt, niemand wollte sich von Sturm und Regen in seiner Nachtruhe stören lassen. So nahm das Unglück, unbeachtet von Behörden und Rettungsdiensten, über viele Stunden seinen verhängnisvollen Lauf.
Andrea Camilleri erzählt in seinem Roman «Berühre mich nicht» die
Geschichte einer Frau, Laura Garaudo, die, nicht ohne Spuren zu hinterlassen,
einfach aus ihrem alten Leben verschwindet.
Durch die Gespräche eines Kommissars mit Ehemann, Liebhabern, Freunden und
Bekannten erfahren wir einiges über Laura Garaudos mehr als unkonventiellen
Lebenswandel. Sie wird von ihren Angehörigen als oberflächlich eingeschätzt und
vorverurteilt. Keine der Personen, die sich über sie äussern, scheinen sie
wirklich gekannt zu haben.
Laura Garaudo hat Kunstgeschichte studiert und zum Gemälde von Beato Angelico
«Noli me tangere» promoviert. Die Darstellung dieser biblischen Szene spielt
eine wesentliche Rolle bei ihrem einsamen Entscheid, alles Bisherige hinter
sich zu lassen für ein radikal anderes Leben.
Irène Némirovsky erweist sich in ihrem Roman "Suite française" als
genaue Beobachterin. Detailgetreu beschreibt sie das Verhalten der Menschen bei
ihrer Flucht vor den Deutschen aus Paris im Jahr 1940. Kostbares
Porzellan, Schmuck, Kleider, Wäsche werden wahllos in Autos geladen oder in den
Gärten vergraben. Rücksichtslos und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht,
versuchen Arme wie Reiche auf ihrer Reise Lebensmittel und Unterkünfte zu
ergattern. Die Strassen sind mit Fliehenden, Autos und Lastwagen verstopft, es
gibt kaum ein Durchkommen. Viele kehren schliesslich nach Paris zurück und
finden ihre Wohnungen unberührt.
In einem Dorf, das 1941 von deutschen Soldaten besetzt wird, versuchen sich die
Einheimischen mit den Besatzern zu arranchieren und stellen fest, dass diese
nicht nur Soldaten, sondern Menschen sind.
Die Schriftstellerin betont die sozialen Missstände jener Zeit in Frankreich;
Hass, Neid und Eifersucht zwischen Adeligen, Bürgern und Bauern sind weit
verbreitet. Arme bestehlen Wohlhabende, die Reichen sind nicht bereit, ihre
gehorteten Güter und Lebensmittel mit den Armen zu teilen.
Irène Némirovsky konnte ihr Werk nicht mehr wie geplant vollenden, sie starb am 17. August 1942 in Auschwitz.
Der Roman von Lukas Hartmann "Auf beiden Seiten" erfordert Kenntnisse über den Kalten Krieg und die Politik der Schweiz in jener Zeit. Die Angst vor dem Feind im Osten war allgegenwärtig und Grund für die Entstehung der geheimen Widerstandsorganisation der Armee, P26 (Projekt der 26 Kantone). Der Autor schildert in seinem Buch die Auswirkungen, die diese Organisation und das politische Klima auf das Leben dreier Familien hatte.
Paolo Cognetti beschreibt in seinem Buch "Acht Berge"
das Leben zweier Freunde, die ihre Kindheit in einem zerfallenden Bergdorf am
Fusse des Monte Rosa verbringen. Beide begleiten den Vater von Pietro schon in
früher Jugend auf Wanderungen in die Berge und auf Gletscher. Sie bleiben
begeisterte Berggänger und mit der grandiosen Landschaft verwurzelt.
Während es den einen der Freunde, Pietro, auch in andere
Weltgegenden zieht, in die Gebirge Nepals, verlässt der andere, Bruno, nie sein
Dorf und versucht vergeblich, eine Existenz aufzubauen. Pietro und Bruno bleiben sich trotz ihrer unterschiedlichen
Lebenswege verbunden, bis Bruno im Lawinenwinter 2014 eines Tages nicht mehr in
seiner Hütte angetroffen wird und verschollen bleibt.
Im Buch "Die Dunkelheit in den Bergen" von Silvio Huonder lässt sich anhand eines nie ganz aufgeklärten, historisch belegten Kriminalfalls im Jahr 1821, die Entstehung eines Rechtssystems im Kanton Graubünden mitverfolgen. Ein fünffacher Mord ist geschehen und Johann Heinrich von Mont macht sich in seiner Funktion als Verhörrichter daran, Licht in die Geschehnisse zu bringen. Mit Kutsche, zu Pferd und zu Fuss werden die wahrscheinlichen Täter durch die eindrücklich beschriebene Berglandschaft verfolgt. Die Gewaltentrennung ist noch nicht vollzogen, Baron von Mont ist Polizeidirektor, Gefängnisleiter, Strafverfolger, Verhörrichter und bald auch erster eidgenössischer Fremdenkommissar in einer Person. Für ihn stehen Recht und Gesetz an oberster Stelle. Todesstrafe und Folter sind an der Tagesordnung. Schon damals gibt es Stress und Personalmangel, zu wenig Landjäger stehen für die Suche nach Verbrechern zur Verfügung. Schliesslich werden die mutmasslichen Täter gefasst, es bleiben aber Zweifel am Tathergang.
Das Buch "Tyll" von Daniel Kehlmann löste bei den
Teilnehmern der Lesegruppe eine sehr engagierte und kontroverse Diskussion aus.
Die einen sahen einen nicht ganz den historischen Tatsachen folgenden Roman,
die anderen konzentrierten sich mehr auf die Figur des Tyll Ulenspiegel.
Dieser lebt als Gaukler und Hofnarr inmitten der Wirren des
Dreissigjährigen Krieges. Er begegnet auf seinem Weg unterschiedlichsten
Menschen, armen, hungernden, einflussreichen, provoziert, bringt unangenehme
Wahrheiten ans Tageslicht. Als Narr darf er das. Unverhofft taucht er auf und verschwindet
dann auf geheimnisvolle Weise. "Tyll" will niemals sterben und rettet sich immer wieder
aus scheinbar ausweglosen Situationen. Ein Buch voller Rätsel!
Mit fantasievoller und kreativer Sprache erzählt die Schriftstellerin
Melinda Nadj Abonji in "Tauben fliegen auf" von der Emigration einer
ungarischstämmigen Familie aus der Vojvodina in die Schweiz. Sie schildert
anschaulich die Zerrissenheit der Menschen zwischen der alten und der neuen
Heimat, die unterschwelligen Diskriminierungen und den Rassismus, denen sie
ausgesetzt sind, trotz Einbürgerung. Heimweh wird spürbar bei Besuchen in der
Vojvodina, nach der Natur, den Tieren, Gerüchen, Familienfesten. Die nachfolgenden Balkankriege hinterlassen tiefe Spuren bis in
die Schweiz. Angehörige werden eingezogen und umgebracht, Land enteignet, die
Bauern vertrieben. Dieser Roman hat uns die Sorgen der Menschen aus den ehemaligen
Balkanstaaten verständlich gemacht.
Im Roman "Der Tod ist ein mühseliges Geschäft" von Khaled Khalifa wird eine Reise durch das kriegsversehrte Syrien für drei Geschwister zum Alptraum. Sie transportieren ihren toten Vater in sein Heimatdorf, wo sie ihn, seinem Wunsch folgend, neben seiner verstorbenen Schwester begraben wollen. Auf der Fahrt müssen sie unzählige Kontrollen von wechselnden Interessengruppen des Bürgerkriegs über sich ergehen lassen. Die Geschwister sind zerstritten, die Familiengeschichte, die im Buch beschrieben wird, scheint ein Abbild der desolaten Situation Syriens. Trotz der widrigen und für den Toten unwürdigen Umstände findet die Reise schliesslich ein Ende. Die Reisenden erreichen ihr Dorf, der Vater kann beerdigt werden, wenn auch weitab vom Grab seiner Schwester. Die Geschwister gehen auseinander, sich fremd geblieben und unversöhnt.
Robert Menasse lässt uns mit seinem Roman "Die
Hauptstadt" einen Blick hinter die Kulissen der Europäischen Union
werfen. Die Kommissionsmitglieder der EU werden von vielerlei Problemen
geplagt, die die politische Arbeit in den Hintergrund rücken lassen.
Das schlechte Image der Kulturkommission soll mit einer
Jubiläumsveranstaltung aufgebessert werden. Doch die Vorschläge der
Generaldirektion Kultur für ein "Big Jubilee Project" stossen auf
wenig Gegenliebe. Auschwitz und die "Überwindung des Nationalgefühls"
sollen zum Thema der Feier gemacht werden. Dieses Vorhaben ruft aber die
Nationen und ihre Vertreter in der EU auf den Plan. Ein vertuschter Mord und ein angeblich umher irrendes Schwein, das
Brüssel unsicher macht, verwirren die Lage zusätzlich. Schliesslich führen persönliche Karrierepläne, Intrigen und
Unstimmigkeiten unter den verschiedenen Nationen zum Scheitern des Projekts.
Viel ist in Vergessenheit geraten vom Leben der Bergbevölkerung
im 19. und 20. Jahrhundert in den Alpentälern der Schweiz. Das Buch "Das
grüne Seidentuch" der Schriftstellerin Marcella Mayer führt uns ins
Bergell und ins Engadin und schildert das Leben ihrer eigenen Vorfahren über
vier Generationen. Für uns sind die harten Arbeitsbedingungen und die beengten
Wohnverhältnisse der damaligen Zeit fast nicht vorstellbar. Sehr gross waren
Solidarität und Hilfsbereitschaft unter den Familien und Dorfbewohnern.
Arbeitsstellen wurden mündlich von Mensch zu Mensch gesucht und gefunden. Trotz
des entbehrungsreichen Lebens erreichten die Menschen nach Aufkommen des
Tourismus und der Fremdenindustrie einen gewissen Wohlstand. Dieser war, und
ist es heute noch, abhängig von den Gästen aus allen Ländern Europas.
Der Roman von Kazuo Ishiguro "Was vom Tage übrig blieb" bescherte uns eine engagierte Debatte über verpasste Gelegenheiten und die politischen und gesellschaftlichen Zwänge Englands zwischen den beiden Weltkriegen.
Auf einer Autofahrt durch England blickt der Butler Mr. Stevens auf Jahrzehnte seines Lebens zurück, die er in unbedingter Loyalität zu seinem Arbeitgeber Lord Darlington auf dessen Landsitz verbracht hat. Mit Wehmut erinnert er sich an seine ungelebte Beziehung zu Miss Kenton, der Haushälterin, ist enttäuscht von den politischen Zielsetzungen des mittlerweile verstorbenen Lord Darlington. Er glaubt, als "grosser Butler" keine Gefühle oder Kritik zulassen zu können. Obwohl er immer wieder die Würde seiner Arbeit, des Arbeitgebers und seiner Gäste betont, missachtet er seine eigenen Bedürfnisse und seine Würde als Individuum.
Letztendlich kehrt er zu seinem neuen Dienstherrn Mr. Farraday nach Darlington Hall zurück mit dem Entschluss, nicht länger zurückzuschauen, sonder das Beste aus dem zu machen, "was vom Tage übrig bleibt."
Das Buch "Gehen, ging, gegangen" von Jenny Erpenbeck hat uns den Albtraum des Flüchtlingsdaseins bewusst gemacht. Richard, ein pensionierter Professor, beginnt sich für die Lebensumstände von Asylbewerbern in seiner Heimatstadt Berlin zu interessieren. Er besucht sie in ihrer Unterkunft, führt viele Gespräche, nimmt an ihrem Tagesablauf teil. Gleichzeitig überdenkt er sein eigenes Leben, die Flucht als Säugling mit der Mutter aus besetzten Gebieten, seine Kindheit in Ostberlin nach dem zweiten Weltkrieg, die Wende. Durch seine persönlichen Erfahrungen ist seine Wahrnehmung geschärft, er begegnet den Flüchtlingen mit grosser Offenheit.
Der Wissenschaftler Daniel Shechtman hat für seine Entdeckung der Quasikristalle 2011 den Nobelpreis für Chemie erhalten.
Im Buch "Quasikristalle" von Eva Menasse verläuft das Leben der Xane Molin wie die Anordnung der Quasikristalle, "geordnet aber nicht ganz regelmässig strukturiert". Die einzelnen Sequenzen dieser Biografie fügen sich wie ein Puzzle ineinander und hinterlassen den etwas zwiespältigen Eindruck einer kämpferischen, selbständigen Ehefrau, Mutter, Freundin, Chefin, Grossmutter. Ein volles Leben wird hier, zum Teil nur andeutungsweise, beschrieben und lässt den Lesern viel Spielraum für eigene Interpretationen.
Obwohl sich nicht alle Teilnehmer unserer Lesegruppe von der bildhaften Sprache der Schriftstellerin Juli Zeh angesprochen fühlten, sorgte die verworrene Beziehung dreier Menschen zueinander, die im Roman "Schilf" geschildert wird, für eine engagierte Diskussion.
Der Streit zweier befreundeter Physiker um parallele Welten, Willensfreiheit und Doppelleben führt zu einem verhängnisvollen Missverständnis mit tragischen Folgen. Ein unbegreiflicher, makabrer Mord ist die Konsequenz dieser heftigen Auseinandersetzung. Dem todkranken Kommissar Schilf gelingt es mit unkonventionellen Ermittlungsmethoden, sowohl den Täter zu finden, wie auch den moralisch Schuldigen mit seiner Verantwortung zu konfrontieren.
Beim Romann "Lügnerin" von Ayelet Gundar-Goshen, gingen die Meinungen weit auseinander. Nicht allen Leseratten gefiel der als
fast märchenhaft empfundene, auf die Probleme Jugendlicher ausgerichtete Stil.
Andererseits wurde uns bewusst, was für einen Einfluss Betroffene und Medien
auf den Gang der Ereignisse haben, wenn es um Uebergriffe, Betrug und Lügen
geht. Solche Skandale können von eigentlich Unbeteiligten für ihre eigenen
Zwecke missbraucht und ausgenutzt werden.
Beim Dezember-Treffen haben wir uns mit den Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die Einwohner Wiens auseinandergesetzt. Was sie bedeuteten, führte uns der Roman "Der Trafikant" von Robert Seethaler drastisch vor Augen. Die Bekanntschaft mit dem Juden Sigmund Freud und der Opportunismus seiner Freundin Anezka liessen den jungen Trafikanten Franz Huchel die Tragweite des Regimes langsam begreifen. Durch das verhängnisvolle Verschwinden seines Arbeitgebers, Otto Trsnjek, wurde aus dem etwas naiven Landburschen ein mutiger Bürger.
Das Buch "Winterjournal" von Paul Auster war Anlass für uns, verschiedene lebensgeschichtliche Themen anzusprechen.
Ist unser Schicksal vorbestimmt oder eben auch beeinflussbar? Die Meinungen gingen auseinander, führten aber zur Frage, inwieweit wir uns absichern können gegen die Folgen von Schicksalsschlägen. Die Schweizer sind ja Meister im Abschliessen von Versicherungen aller Art.
Wie steht es mit der Notwendigkeit eines Vorsorgeauftrags, wann und wie sollte dieser erstellt werden? Auch dieses Problem wurde rege erörtert.
Bewundert haben wir Paul Auster für seinen Entschluss, das Autofahren nach einem schweren Autounfall von einem Tag auf den anderen aufzugeben. Hier wurde das Erkennen des richtigen Zeitpunkts zum Thema.
Viel zu reden gaben auch die vielen Wohnsitzwechsel des Autors. Sie sind wohl der Grösse der USA geschuldet, wo man eher einem Arbeitsplatz nachzügelt als in der kleinräumigen Schweiz.er 13. September 2017 war dem Buch "Die dunkle Seite der Liebe" von Rafik Schami gewidmet. Auf eindrückliche Weise erzählt der Schriftsteller die dramatische Geschichte zweier verfeindeter Familien in Damaskus. Er schildert die Lebensweise, Bräuche und Kultur im Syrien des letzten Jahrhunderts und gibt uns einen Einblick in eine völlig fremde Welt. Politik spielte sich innerhalb der Familien und Clans ab, wohl bis in die heutige Zeit. Nur wer sich in dieses System einfügte hatte die Chance, in Ruhe und unbehelligt von Denunziation und Verhaftung leben zu können.
Die Diskussion drehte sich denn auch um unsere eigenen Erfahrungen mit Zwängen und Vorschriften in der westlichen Welt und im eigenen Umfeld.
Den "Mitternachtsweg" zu beschreiten ist ein gefährliches Unternehmen, besonders wenn mysteriöse Ereignisse mitspielen, wie im Buch von Benjamin Lebert, das wir am 19. Juli 2017 diskutierten. Wanderungen übers Wattenmeer, das geheimnisvolle Verschwinden von Menschen und ihr Auftauchen als "Wiedergänger" wird in vielen Legenden und Sagen aus nördlichen Ländern überliefert. Solche Geschehnisse lassen sich mit dem Verstand nicht erfassen. In unserer Diskussion versuchten wir, die rätselhaften Begebenheiten einzuordnen im Wissen, dass viele unbegreifliche Vorfälle zwischen Himmel und Erde letztlich nicht zu erklären sind.
Unsere März-Lektüre führte uns in eine ganz andere Welt.
Wir haben uns für den Roman "Kinder des Ungehorsams" von Asta Scheib, dtv Verlag entschieden. Er schildert das biographisch nachempfundene Leben der Nonne Katharina von Bora und des Mönchs Martin Luther und deren Heirat. Was damals unvorstellbar war, wäre auch heute sicher mit grossen Schwierigkeiten verbunden.
Unsere Diskussion am 10. Januar 2017, über das Buch "Cox oder Der Lauf der Zeit" von Christoph Ransmayr, stand ganz im Zeichen Chinas, geheimnisvollen Uhrwerken, der Dauer der Ewigkeit. Die lebhafte Debatte berührte viele auch aus heutiger Sicht aktuelle Fragen: den Umgang mit Macht und Bürgerrechten, unser individuelles Zeitempfinden, das Leben im heutigen China im Vergleich zur Zeit des im Buch thematisierten Kaiserreichs.
Eine Neuerscheinung Cox oder Der Lauf der Zeit, von Christoph Ransmayr, S. Fischer Verlag, ein farbiger Roman in einem märchenhaften China. Hier noch zwei Links zu diesem Buch: Inhalt und ein Hinweis im Tagi.
Der "Niedergang" von Roman Graf: Die dramatische Erzählung einer mangelhaft vorbereiteten und unverantwortlich durchgeführten Bergtour, die die trostlose Beziehung der beiden Beteiligten widerspiegelt. Näheres zum diskutierten Buch "Niedergang" kann hier nachgelesen werden.
Das Buch "Der Fälscher, die Spionin und der Bombenleger" von Alex Capus. Die vielschichtigen Biographien dreier Schweizer Bürger führten zu interessanten Überlegungen, unter anderem bezüglich der Rolle der Schweiz im zweiten Weltkrieg, dessen Auswirkungen das Leben der drei Menschen beeinflusste.
Zum ersten Mal haben wir uns am 23. August 2016 in den gediegen renovierten Räumen an der Stallikonerstr. 54 getroffen. Gelesen und diskutiert haben wir das Buch: "Am Hang" des verstorbenen Schriftstellers Markus Werner. Es lohnte sich, den Band zweimal zu lesen, weil sich viele rätselhafte Passagen der spannenden Handlung erst im Wissen um den Schluss erklären liessen.
Bei Bedarf ein Hinweis zu Buchbestellungen.